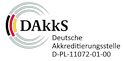Forschungsprojekte der DBI-Gruppe
Unsere Forschung leistet einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung der Energiezukunft. Im Fokus stehen innovative Technologien und Konzepte zur Nutzung, Umwandlung und Speicherung von Gasen, zur Dekarbonisierung der Energieversorgung sowie zur Umsetzung der Energiewende. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über unsere aktuellen und abgeschlossenen Forschungsprojekte.
Unsere Highlights

Das Projekt Energiepark Bad Lauchstädt ist ein großtechnisch angelegtes Reallabor zur intelligenten Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung von grünem Wasserstoff – erstmals wird hier Windstrom aus einem nahegelegenen Windpark direkt in einer 30‑MW-Elektrolyseanlage zu Wasserstoff umgewandelt, in einer Salzkaverne gespeichert und anschließend über eine umgerüstete Gaspipeline zur industriellen Nutzung, z. B. zur Raffinerie in Leuna, eingespeist.
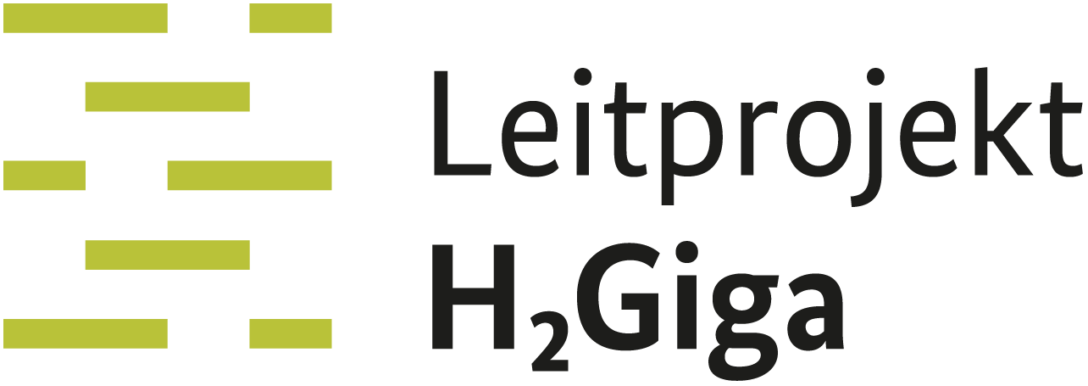
Das Leitprojekt H₂Giga zielt darauf ab, die Voraussetzungen für die industrielle Serienfertigung von Elektrolyseuren zu erforschen. Neben technischen und ökonomischen Fragestellungen stehen auch nicht-technische Herausforderungen im Fokus. Der Verbund Technologieplattform Elektrolyse (TPE) widmet sich dabei insbesondere den Themen Normierung, rechtliche Rahmenbedingungen und Qualifizierung.

Das Projekt Leuna100 demonstriert erstmals im industriellen Maßstab eine vollständig gekoppelte Prozesskette zur Herstellung von grünem Methanol aus CO2 und grünem Wasserstoff im Chemiepark Leuna. Dabei kommen innovative Technologien wie CO-Elektrolyse, Reverse-Water-Gas-Shift und eine neuartige homogene Katalyse zum Einsatz, um einen lastflexiblen und skalierbaren Betrieb zu ermöglichen.

Das Projekt H₂Infra untersucht im Wasserstoffdorf Bitterfeld den sicheren und effizienten Betrieb von Wasserstoffverteilnetzen in einem 1,4 km langen Testnetz. Dabei werden Materialien, Sicherheitstechnik und Verbrauchergeräte wie Wasserstoff-Thermen erprobt, um Standards und Grundlagen für den breiten Einsatz von Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen.
Weitere Forschungsprojekte
Aktuelle Forschungsprojekte (Auswahl)
Das Vorhaben zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und die geopolitische Stabilität der Europäischen Union zu stärken, indem das Potenzial Griechenlands für erneuerbare Energien und den daraus produzierbaren grünen Wasserstoff sowohl für den Eigenbedarf als auch für Exporte analysiert wird. Durch diese Analyse soll der Rahmen für den Transport von Exportkapazitäten über bestehende Pipelinesysteme nach Deutschland und in die EU bestimmt und bewertet werden. Dabei werden systemische Effekte berücksichtigt und die Umsetzbarkeit durch Evaluierung aktueller und zukünftiger technischer sowie regulatorischer Rahmenbedingungen geprüft.
Laufzeit
01.01.2026 – 31.12.2027
Förderkennzeichen
03SF0795A
Gefördert vom
PTJ / BMFTR
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines anwendungsnahen vorwettbewerblichen Funktionsmusters mit optischer Spurengasmesszelle zur schnellen quantitativen und ortsaufgelösten Erfassung von Wasserstoff, welches unter realen Einsatzbedingungen validiert wird. Dafür wird ein neuartiges Messsystem entwickelt, welches auf der periodisch spektral durchstimmbaren Laserspektroskopie basiert.
Laufzeit
15.05.2025 – 30.11.2028
Förderkennzeichen
100741445
Gefördert vom
SAB
Teilvorhaben DBI: Entwicklung von Konzepten zur Aufbereitung der Produkt-Gasströme aus dem Plasmasystem und der Membranextraktion inkl. einer Carbon-Footprint- sowie GIS-Analyse zum Marktpotenzial
Die weltweiten Klimaziele und der Umbau des Energiesystems erfordern neue Wege zur Bereitstellung, Speicherung und zum Transport von grünem Wasserstoff. Während der direkte Transport von Wasserstoff technisch und wirtschaftlich aufwendig ist, bietet Ammoniak (NH3) als Wasserstoffträger bedeutende Vorteile: eine hohe Energiedichte, etablierte Transportinfrastrukturen und geringere Sicherheitsanforderungen. HydrAPlas greift diese Möglichkeit der Ammoniakverwendung auf und entwickelt eine innovative Technologie zur energieeffizienten Rückwandlung von Ammoniak in Wasserstoff am Ort des Verbrauchs. Parallel dazu wird erstmals der Ansatz verfolgt, Ammoniak aus regionalen Reststoffströmen – etwa aus kommunalen oder industriellen Abwässern – zu gewinnen und für die Wasserstofferzeugung nutzbar zu machen.
Laufzeit
01.05.2025 – 30.04.2028
Förderkennzeichen
03EI3113B
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Das Forschungsprojekt SafeH2Supply verfolgt das übergeordnete Ziel, eine sichere, qualitativ hochwertige und umweltverträgliche Wasserstoffversorgung zu gewährleisten. Im Fokus steht die Sicherheit bei einem möglichen Gasaustritt im öffentlichen Raum durch die Odorierung von geruchlosem Wasserstoff. Hierzu werden neue Odoriermittel unter realen Einsatzbedingungen getestet, deren Wechselwirkungen mit Endgeräten analysiert und die Notwendigkeit einer Deodorierung bewertet.
Laufzeit
01.04.2025 – 31.12.2027
Förderkennzeichen
100749060
Gefördert vom
SAB
Ziel des Vorhabens ist eine umfassende Charakterisierung der Resilienz des Wasserversorgungssektors und der Wasserspeichersysteme am Beispiel Landkreis Mittelsachsen. Hierfür werden die für die Wasserversorgung relevanten Komponenten (insbesondere Wasserspeicher) im Hinblick auf Bedeutung, Beladung, Entleerung, zeitliche / räumliche Variabilität, Wasserqualität, ökologische Bedeutung, energetische Nutzungsmöglichkeit und Vulnerabilität bewertet. Basierend auf den gewonnenen Daten werden sektorale und anschließend gesamtheitliche Systemmodelle erstellt, die die Resilienz der Wasserversorgung eruieren.
Laufzeit
01.03.2025 – 29.02.2028
Förderkennzeichen
02WAZ1746E
Gefördert vom
Projektträger Karlsruhe / Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Gesamtziel des Projektes ist die energetische Verwertung von Abfallstoffen (Fraß) aus der Zucht und Verarbeitung der Schwarzen Soldatenfliege (black soldier fly, BSF) im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Die hochautomatisierte Insektenzuchtanlage der madebymade GmbH stellt eine innovative Nutzung organischer Abfallstoffe als Futter für die Larven der BSF dar. Ziel ist die Umwandlung der organischen Abfallstoffe in hochwertiges Insektenprotein und -fett. Als Nebenprodukt fällt Fraß an, dessen Verwertung aktuell ein Problem darstellt. Das Projekt setzt hieran, in dem ein spezieller Biogasprozess für die Verwertung des Fraßes als Substrat entwickelt wird. Das Ziel ist die effiziente Nutzung des energetischen Potenzials dieses Substrats, wodurch der nachhaltige und ressourcenschonende Kreislauf der madebymade GmbH weiter verbessert wird.
Laufzeit
01.01.2025 – 31.12.2027
Förderkennzeichen
100692840
Gefördert von
SAB
Ziel des KMU-innovativ Projekts CLeo ist die Entwicklung einer Inline-Qualitätsprüfung, die Leckagen erkennt, ohne die Struktur der Membran zu beeinflussen. Dazu ist eine Prüfkammer prototypisch zu erarbeiten, in der Filtermodule mit Kantenlängen >1m mit einem Prüfgas beaufschlagt und eventuelle Leckagen über Spektroskopie örtlich aufgelöst detektiert werden. Zunächst wird das mechanische und optische Grundkonzept der Zelle erstellt und mögliche Komponenten, z.B. für das automatische Handling der Module, werden ausgewählt. Die Korrelation zwischen Leckstrom und Detektionssignal wird ermittelt und eine KI-basierte Bildverarbeitung umgesetzt.
Laufzeit
01.01.2025 – 31.12.2026
Förderkennzeichen
02P24K140
Gefördert vom
KMU-innovativ PTKA / BMBF
BLWH2 verfolgt das Ziel konkrete Versorgungsmöglichkeiten für unterschiedliche Abnehmer mit Abwärme aus der Elektrolyse zu erforschen, zu bewerten und daraus umfassende Konzepte für eine sichere Versorgung urbaner Gebiete zu entwickeln. Im Zuge dieser Bemühungen soll die Wertschöpfungskette des naheliegen den Reallabors „Energiepark Bad Lauchstädt“ erweitert werden. Aufgrund der Standortnähe zum Reallabor, bietet die Stadt Bad Lauchstädt eine optimale Möglichkeit zur Umsetzung und besitzt damit zum aktuellen Zeitpunkt ein Alleinstellungsmerkmal im gesamten
Bundesgebiet.
Laufzeit
01.11.2024 – 31.10.2026
Förderkennzeichen
03EN3108A
Gefördert vom
BMWK
Aufbauend auf den aktuell in der Quartiersplanung üblichen Heizlastprofilen (Standardlastprofile) sollen Kühllastprofile entwickelt werden. Parallel dazu werden verschiedene Kühlszenarien für Sachsen abgeleitet und die Kühlbedarfe standortabhängig simuliert. Die daraus entstehende “Kältekarte Sachsen” wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gibt sowohl Kommunen als auch Energieversorgern und Privathaushalten die Möglichkeit z.B. abschätzen zu können, ob bei einer Sanierung zukünftige Kühltechnologien zu integrieren sind. Um die Auswahl der jeweils passenden Technologie zu erleichtern, wird ein techno-ökonomischer Vergleich durchgeführt und als Leitfaden aufgearbeitet.
Laufzeit
27.09.2024 – 30.11.2027
Förderkennzeichen
100746672
Gefördert vom
SAB / EFRE – Anwendungsorientierte Forschung
Das Forschungsvorhaben „NACH-WÄRM“ zielt auf die Substitution von Erdgas als Brennstoff in den Prozessketten der gieß- und umformtechnischen Verarbeitung von Stahl und Gusseisen ab. Konkret werden die Prozesse der Bauteilerwärmung bzw. die Wärmebehandlung in gasbetriebenen Öfen in den Fokus der Untersuchungen gerückt. Um zur Dekarbonisierung dieser Industrien beizutragen, werden zwei Lösungskonzepte betrachtet, wobei zum einen H2 bzw. H2-Gemische als Brenngas und zum anderen die Heißgasfackel eines elektrischen Plasmabrenners eingesetzt wird.
Ein Ziel des geplanten Vorhabens ist es daher zum einen, eine nachhaltige wasserstoffbasierte Erwärmungstechnologie für die Ur- und Umformtechnik zu entwickeln, bei der es zu keiner kritischen Wechselwirkung zwischen Brenngas und Werkstück kommt.
Laufzeit
01.08.2024 – 31.07.2027
Förderkennzeichen
100723028
Gefördert von
SAB
Ziel im Projekt HyNRGCube ist die Überführung des Honda-PEM-Brennstoffzellenmoduls von der mobilen in die stationäre Nutzung. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt dabei auf der Systemumgebung für das Brennstoffzellenmodul und den Anforderungen an das Gesamtsystem, die aus dem Brennstoffzellenmodul und der H2-Infrastruktur resultieren, um sowohl Wirkungsgrad als auch Lebensdauer in die stationäre Anwendung zu überführen. Die Erprobung eines H2-BHKW Prototypen mit mind. 60 kW elektrischer Leistung wird in anwendungsnaher Umgebung, z.B. auf dem H2-Netz Versuchsgelände im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, erfolgen.
Laufzeit
01.07.2024 – 30.06.2027
Förderkennzeichen
03EN5045C
Gefördert vom
PtJ-Forschungszentrum Jülich GmbH
Das Gesamtziel besteht in die Entwicklung eines neuartigen, CO2-minimierten, dekorativen Heizungssystems auf der Basis von Bio-Ethanol, welches anschlussfrei in vorhandene bzw. neu zu errichtende Gebäude mit automatischen Be- und Entlüftungssystem, bevorzugt mit Wärmerückgewinnung, integriert werden kann. Der Brennstoff Bio-Ethanol wird aus nachwachsender Biomasse gewonnen, wodurch das zu entwickelnde System einen verminderten CO2-Ausstoß im Vergleich zu den mit fossilen Energieträgern betriebenen Anlagen aufweist. Das zu entwickelnde System soll sowohl als dekoratives Element im Haushalts- und Gewerbebereich, als auch als weitestgehend CO2-neutrales Heizungssystem mit einer thermischen Leistung von 2 bis 4,5 kW eingesetzt werden können.
Laufzeit
01.06.2024 – 30.05.2026
Förderkennzeichen
100690851
Gefördert vom
SAB
Ziel des Projektes „TrafoAMA“ soll es sein, für Anlagenbetreiber und Hersteller Transformationspfade inklusive technischer Lösungen zu erarbeiten, damit Asphaltmischanlagen zukünftig einen emissionsfreien und CO2-neutralen Betrieb gewährleisten können. Insbesondere aufgrund der sehr spezifischen regionalen Versorgungs- und Lieferstrukturen müssen solche Transformationspfade auf die regionalen Gegebenheiten und angebotenen Produkte angepasst werden.
Laufzeit
01.03.2024 – 31.08.2026
Förderkennzeichen
49MF230028
Gefördert vom
EURONORM / BMWK
Innovation des Projektes „InnoCarb“ ist die wissensbasierte Entwicklung von Hochleistungsaktivkohlen für die Reinigung von wasserstoffhaltigen Prozessgasen auf bis zu 99,5 Vol.-% H2. Basis sind spezielle Aktivkohlen des Verbundkoordinators Skeleton Materials GmbH (SMG), welche sich in grundlegenden Eigenschaften wie Porengröße und Funktionalisierung von gängigen marktverfügbaren Materialien unterscheiden. Dieses materialtechnische Potential wird auf die Anwendung der Gasreinigung biogener wasserstoffhaltiger sowie chemisch-katalytischer Prozessgase übertragen (siehe Abbildung 1). Neben der materialtechnischen Optimierung der Aktivkohlen zur selektiven Abscheidung von CO und CO2 aus wasserstoffhaltigen Prozessgasen, werden die typischen Begleitgase CH4, H2O und N2 mitbetrachtet. Das verfahrenstechnische Prinzip der Druckwechseladsorption (DWA) muss auf diese speziellen Aktivkohlen angepasst werden. Über die Auswahl der passenden Verfahrensparameter soll eine gezielte Einstellung der Produktgaszusammensetzung von H2 und CO2 möglich werden, um speziellen Anwendungszwecken wie der Methanolsynthese zweckdienlich zu sein. Adressierte Anwendungsfelder für „InnoCarb“ sind Trennaufgaben in der Biogasreformierung, Erdgasreformierung oder auch der biogenen Wasserstofferzeugung. Zur Erreichung dieser Ziele steht entsprechendes Knowhow im verfahrenstechnischen Bereich am DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg zur Verfügung.
Laufzeit
01.01.2024 – 31.12.2026
Förderkennzeichen
03EI3091B
Gefördert vom
PtJ / BMWK
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Reinigungssystems für Stallabluft im Sinne eines Trockenverfahrens, bestehend aus der Kombination eines speziellen Multizyklons mit einem segmentierten Metallkatalysator unter Verwendung von elektrisch beheizbaren, katalytisch beschichteten, offenporigen, thermisch stabilen Metallstrukturen zur Beseitigung störender Gerüche, Ammoniakemissionen und Staub aus Stallanlagen mit dem Ziel der Einhaltung der NEC-Richtlinie (National Emission Ceilings Directive), Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU und TA Luft. Für den energieeffizienten Betrieb der Anlage wird eine Anlage zur Rückgewinnung der Wärme des Reingases mit dem Ziel der signifikanten Minimierung der Wärmeverluste in das System integriert und mittels einer intelligenten Steuerungstechnik geregelt.
Laufzeit
01.12.2023 – 30.11.2025
Förderkennzeichen
100693868
Gefördert vom
SAB/EFRE / Verbundförderung
Ziel des Vorhabens „HLSG-CH₄“ ist die Entwicklung eines neuartigen mobilen Gasmesssystems zur Detektion von Methan im Spurenbereich ab 100 ppb (Nachweisgrenze) mit einer Messauflösung von 10 ppb. Die bisher am Markt befindlichen mobilen Systeme arbeiten im Bereich von Methankonzentrationen ≥1 ppm. Die Innovation des Projektes liegt in der geometrischen und messtechnischen Verknüpfung eines Hohlleiters mit einem Resonator. Hierfür werden neuartige metallisierte Glashohlleiter mit Querschnitten von bis zu 2 mm und sehr geringer Dämpfung (< 0,5 dB/m) im Infrarotspektralbereich entwickelt. Eine weitere Innovation stellt die hochintegrative Sender-Empfänger-Einheit dar, welche monolithisch mit dem Hohlleiter gasdicht verbunden werden soll. Die Validierung des Messkonzeptes erfolgt im akkreditierten Prüflabor, um unter Anderem das Ansprechverhalten des Sensors, Quereinflüsse auf die Messung oder die Linearität des Messsignals über mehrere Größenordnungen zu untersuchen. Die Praxistauglichkeit wird mit einem Prototyp im Feldtest evaluiert. Hierzu wird das Gerät unter realen Einsatzbedingungen bei der Wartung von Gasanlagen im Biogasbereich verwendet, um es mit bestehender Messtechnik zu vergleichen.
Laufzeit
01.04.2023 – 31.03.2026
Förderkennzeichen
01LY2210A
Gefördert vom
DLR Projektträger
Abgeschlossene Forschungsprojekte (Auswahl)
Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines aktuellen und praxisnahen Genehmigungsleitfadens und technischen Leitfadens für den Bau und Betrieb von Wasserstoffnetzinfrastrukturen. Die Leitfäden werden so ausgearbeitet, dass sie sowohl Planern und Betreibern als auch Behörden als Werkzeug für eine einfache und schnelle Genehmigung dienen können. Es soll sowohl die Neuerrichtung von Wasserstoffleitungen als auch die Umstellung bestehender Erdgasinfrastrukturen für Wasserstoff betrachtet werden.
Laufzeit
01.01.2023 – 31.12.2025
Förderkennzeichen
03EI3078A
Gefördert vom
Projektträger Jülich
Bundesministerium für Wirtschaft & Klimaschutz
Das Kernziel des Projektes GEoQart ist es, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Errichtung von Versorgungsnetzen zur Energieversorgung mittels Grubenwassergeothermie in Modellquartieren zu analysieren. Hierbei wird das Potenzial des Grubenwassers an verschiedenen Standorten bestimmt sowie mögliche Versorgungsnetze zum Heizen und Kühlen von Gebäuden trassiert. Um den notwendigen Strombedarf zu decken, werden ebenso Potenziale für Photovoltaik auf den Dächern der Gebäude in den Modellquartieren standortgenau berücksichtigt. Als Projektergebnis wird ein allgemeingültiges Analysewerkzeug entwickelt, welches auch außerhalb der Modellquartiere zur Anwendung kommen soll.
Laufzeit
01.10.2022 – 30.09.2025
Förderkennzeichen
03EN6015B
Gefördert vom
Projektträger Jülich
Bundesministerium für Wirtschaft & Klimaschutz
Ziel des Projektes „BioKon“ ist die Optimierung des Verfahrens der biologischen Methanisierung in der Blasensäule hinsichtlich des Gaseinbringsystems und der Mikrobiologie. Damit wird ein Verfahren zur Konversion von regenerativem Kohlenstoffdioxid und (Elektrolyse)-Wasserstoff zu Methan mittels biologischer Methanisierung in der Blasensäule etabliert, welches für die
Nachrüstung auf Biogasanlagen geeignet ist. Durch den Einsatz eines neuartigen Gasinjektionssystems als effizienzbestimmendes Bauteil dieses Prozesses wird die Erzeugung von einspeisefähigem Methan (> 95 Vol.-%) angestrebt. Ein molekularbiologisches Monitoring der systemrelevanten Mikroorganismen und eine Optimierung der Bedingungen für die relevanten Leistungskulturen zielen auf einen stabilen und leistungsfähigen biologischen Prozess. Hinsichtlich der Volatilität von Wind- und Sonnenstrom wird somit im Rahmen der Bioökonomie der regenerative Energiespeicher Biomethan vorangetrieben (Sektorkopplung Strom und Gas).
Laufzeit
01.10.2022 – 29.09.2025
Förderkennzeichen
031B1294A
Gefördert vom
Projektträger Jülich
Bundesministerium für Bildung und Forschung
KMU-innovativ: Bioökonomie
Das Projekt MineATES setzt es sich zum Ziel, grundwassergefüllte bergbauliche Hohlräume (ehemalige untertägige Bergwerke) bezüglich ihrer Eignung für geothermische Zwecke (Kälte- und Wärmespeicher) systematisch zu bewerten. Dazu werden Versuche und Untersuchungen untertage und übertage durchgeführt und die Reaktionen des Systems analysiert. Die Analysen der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH fokussieren hierbei auf die übertägigen Schwerpunkte und das Schnittstellenmanagement. Die Aufteilung auf die einzelnen Projektschwerpunkte ist in nachfolgender Abbildung dargestellt (Teilprojekt DBI: Schwerpunkt IV)
Laufzeit
01.07.2022 – 30.06.2025
Förderkennzeichen
03G0910B
Gefördert vom
Projektträger Jülich
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Das SYMBOKO-Projekt hatte das Ziel, ein innovatives, klimaneutrales Verfahren zur Herstellung von Methanol aus Biogas zu entwickeln. Im Fokus stand dabei die vollständige stoffliche Nutzung der im Biogas enthaltenen Kohlenstoffverbindungen unter Einbindung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen. Die Projektarbeiten erfolgten im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Verbundvorhabens unter Beteiligung mehrerer Industrie- und Forschungspartner. Der wissenschaftlich-technische Hintergrund ist in der übergeordneten Notwendigkeit zu verorten, emissionsintensive Produktionspfade in Industrie und Mobilität durch erneuerbare, CO2-neutrale Alternativen zu ersetzen. Methanol gilt in diesem Zusammenhang als ein vielversprechender Plattformstoff, der sowohl als Energieträger als auch als chemischer Grundbau-stein breite Anwendung findet.
Laufzeit
01.08.2021 – 30.09.2024
Förderkennzeichen
03EE5070A
Gefördert vom
BMWK
Die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff spielt eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens zur Begrenzung der anthropogenen Erwärmung auf 1,5 bis 2 °C. Eine Möglichkeit ist die CO2-Speicherung durch Mineralkarbonisierung, wobei im Gegensatz zur kontrovers diskutierten CCS-Technik, kritische Punkte wie Langzeitdichtheit bzw. unkontrollierter CO2-Austritt bei der angestrebten Technologie „BioClean“ prinzipiell keine Rolle spielen. Dieser Ansatz verspricht dem Kohlenstoffkreislauf dauerhaft CO2 zu entziehen und im Untergrund zu speichern.
Laufzeit
01.01.2022 – 31.12.2024
Förderkennzeichen
49VF210043
Gefördert vom
EURONORM/ BMWi
Das Ziel des geplanten FuE-Projektes ist die Entwicklung eines innovativen aufeinander abgestimmten Reinigungssystems auf Basis von günstigen Eisenoxo-Spezies sowie natürlichen Zeolithen zur kombinierten Entfernung von flüchtigen Methylsiloxanen (engl. VMS, volatile methylsiloxanes) und H2S, wobei die H2S-Entfernung zur Schonung des Zeolithmaterials vorgeschalten werden soll.
Laufzeit
01.09.2022 – 31.08.2024
Förderkennzeichen
38028/01-24/0
Gefördert vom
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Im Rahmen des Förderprojektes „Emissionsminderung an Holz-Kleinfeuerungsanlagen“ (Emin koNa), wurde am DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg (DBI-GTI) ein innovatives Reinigungssystem zur Entfernung von Staub, Kohlenstoffmonoxid und gasförmigen organischen Verbindungen aus Holzfeuerungsanlagen entwickelt. Die angestrebte Lösung orientiert sich an den akuten Belangen der Branche und ist anwendungsoffen in der Praxis umsetzbar.
Laufzeit
01.01.2022 – 30.06.2024
Förderkennzeichen
49MF210144
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
DBI: Demonstratorentwicklung und Erprobung anwendungsnaher Katalysatoren
Bei der motorischen Verbrennung von Biogas entstehen in geringem Umfang Emissionen wie z. B. Methan, die einen höheren Treibhausgasfaktor haben im Vergleich zu CO2. Die bisherigen technischen Lösungen, wie die Methanoxidation an Edelmetallkatalysatoren, erreichen nur eine unzureichende Minderung der Emissionen oder eine ungenügende Standzeit und können die geplanten Abgasgrenzwerte nicht mehr einhalten. Insbesondere ist die Schädigung der Katalysatoren durch Schwefel im Biogas dafür verantwortlich. Mit dem Projektziel, der Entwicklung eines neuartigen edelmetallfreien und schwefelresistenten Katalysators für die Oxidation von Methan (CH4), Formaldehyd (CH2O) und Kohlenmonoxid (CO) im Abgas von stationär betriebenen mageren Gasmotoren, soll eine neue technische Lösung gefunden werden. Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH arbeitet zusammen mit der Professur Reaktionstechnik der TU Bergakademie Freiberg und der Völkl Motorentechnik GmbH an der Demonstratorentwicklung und Erprobung anwendungsnaher Katalysatoren und unterstützt im Projekt mit Modellierungen und experimentellen Untersuchungen die Entwicklung.
Laufzeit
01.06.2021 – 31.05.2024
Förderkennzeichen
2220NR263B
Gefördert vom
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe / Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Ziel des Projektes ProMem soll ein umfangreicher Eignungstest von anorganischen Membranen für einen breiten Anwendungsbereich zur Entwässerung flüssiger Medien (Membranscreeining) sein.
Es werden verschiedene Membrantypen untersucht werden, die sich in Polarität, Hydrophilie, Porenweite sowie in ihren allgemeinem physikalisch-chemischen Eigenschaften unterscheiden. Daraus sollen Anwendungsbereiche identifiziert und damit eine Eignungsbewertung sowie Verwendungsempfehlung der Membranen abgeleitet werden. Somit ist das übergeordnete Projektziel die Entwicklung von Applikationsmöglichkeiten zur Entwässerung von chemischen Stoffgemischen in flüssiger Phase mittels anorganischer Membranen für definierte Reaktionsbedingungen.
Laufzeit
01.11.2021 – 31.03.2024
Förderkennzeichen
49MF210135
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Laufzeit
01.04.2022 – 29.02.2024
Förderkennzeichen
372153 304 0
Gefördert vom
Umwelt Bundesamt
Das F&E-Projekt COnnHy zielt auf die Entwicklung eines Verfahrens zur CO2-freien Wasserstofferzeugung aus Erdgas oder Biogas in einem zweistufigen Prozess. Als Nebenprodukt entsteht fester Kohlenstoff, anders als bei den bekannten Pyrolyseverfahren jedoch nicht in einem Hochtemperaturreaktor. Das Verfahren stellt somit einen innovativen Ansatz zur Gewinnung von türkisem Wasserstoff dar und kann dazu beitragen, das Potential für emissionsfrei erzeugten Wasserstoff für eine künftige Wasserstoffwirtschaft zu erhöhen. Im Rahmen des Vorhabens sollen durch umfangreiche Voruntersuchungen Auslegungsgrundlagen und Konzepte erstellt werden, die eine spätere Umsetzung im Demonstratormaßstab ermöglichen.
Laufzeit
01.08.2021 – 31.01.2024
Förderkennzeichen
49MF210058
Gefördert vom
EURONORM/BMWi
Ziel und Innovation des Forschungsvorhabens „BioMeth“ ist die Entwicklung eines Verfahrens zur Synthese von Biomethanol auf der Basis biogenen Wasserstoffs, um im Mobilitätssektor als Kraftstoff bzw. Kraftstoffzusatz zu dienen oder in technischen Prozessen wie der Biodieselherstellung konventionelles Methanol zu substituieren. Mittels des zweistufigen Biogasprozesses können kontinuierlich zwei biogene Gase – ein wasserstoffhaltiges und ein methanhaltiges Biogas – erzeugt werden.
Laufzeit
01.08.2020 – 31.12.2023
Förderkennzeichen
03EI5423A
Gefördert vom
Projektträger Jülich / BMWi
Im Projekt wurden Untersuchungen zu Veränderungen der Strahlungseigenschaften von Flammen und deren Geometrie mit Blick auf die Parameter der Flammendetektion bei steigender, schwankender bzw. sehr hoher Wasserstoffanteile in Erdgas durchgeführt. Aus den Erkenntnissen veränderlicher Flammensignale wurden Modelle zur adaptiven Regelung des Gas-/Luft-Gemisches zur Kompensation von Schwankungen der Brenngas- und Oxidator-Zusammensetzung entwickelt.
Die neuartige Verbrennungsregelung wurde anhand verschiedener Brennerarten ausgehend von Laborversuchen bis hin zum realitätsnahen Anwendungsfall erprobt. Die gewonnen Erkenntnisse bezüglich Einsetzbarkeit der Verbrennungsregelung in verschiedenen
Prozessen, Regelgrenzen und konstruktiver Einbaukonzepte zur Flammenüberwachung wurden in abschließenden Handlungsempfehlungen zusammengefasst.
Laufzeit
01.01.2021 – 31.12.2023
Förderkennzeichen
32 LBG
Gefördert vom
IGF / BMWK
Im Rahmen des Vorhabens wurden Konzepte und Empfehlungen erarbeitet und validiert, mit denen ein sicherer und wirtschaftlicher Betrieb von Thermoprozessanlagen unter Einfluss von Wasserstoff im Brenngas möglich ist. Final wurde ein Komplexversuch unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse aus den Teilprojektendes Leittechnologievorhabens TTgoesH2 durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in Handlungsempfehlungen zusammengefasst.
Laufzeit
01.01.2021 – 31.12.2023
Förderkennzeichen
31 LBG
Gefördert vom
IGF / BMWK
Der Ballungsraum Halle-Leipzig ist traditionell ein Standort der chemischen Industrie. Die Grundstoffindustrie ist ein großer CO2 Emittent. Gleichzeitig existiert ein großer Bedarf an Kohlenstoffträgern für viele Syntheseverfahren. Die beteiligten Unternehmen wollen den Strukturwandel mit der Treibhausgasminderung so meistern, dass der Rohstoffverbund in die Zukunft geführt wird. Das Projekt CapTransCO2 wird Konzepte entwickeln, wie der prozessbedingte CO2-Anfall gesammelt, konditioniert, genutzt und sicher transportiert werden kann.
Laufzeit
01.10.2021 – 30.09.2023
Förderkennzeichen
03EE5111A
Gefördert vom
BMWK
Antibiotika sind seit ihrer Entdeckung und medizinischen Verwendung das wichtigste Werkzeug für die Behandlung von bakteriellen Infektionskrankheiten. Daher werden sie in der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt, um krankheitserregende Mikroorganismen zu bekämpfen. Je nach Antibiotikum wird zwischen 10 % und 90 % des Ausgangsstoffes metabolisiert. Sowohl die unmetabolisierten als auch die metabolisierten Transformationsprodukte werden ausgeschieden und gelangen ins Abwasser und anschließend in die Kläranlage. Darüber hinaus werden Antibiotika durch unsachgemäße Entsorgung über die Kanalisation in die Abwässer eingeleitet, wodurch diese ebenfalls in die Kläranlage gelangen. In Anhängigkeit der einzelnen Antibiotika, werden diese langsam durch Mikroorganismen metabolisiert, adsorbieren am Klärschlamm, verändern das Mikrobiom im Klärwerk oder gelangen unmetabolisiert in den Vorfluter. Besonders der Austrag von unmetabolisierten Antibiotika oder deren Transformationsprodukte ist kritisch für aquatische Systeme. Bakterien besitzen die natürliche Eigenschaft (z. B. durch Mutation oder Gentransfer) sich an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen. Dies bedeutet, dass krankheitserregende Bakterien Resistenzen gegen ein oder sogar mehrere Antibiotika ausbilden. Aktuelle Untersuchungen von Murray et al. (2022) zu antibiotikaresistenten Bakterien haben gezeigt, dass jährlich ca. 1,27 Mio. Menschen weltweit an Infektionen mit resistenten Mikroorganismen sterben, wobei man bisher von 700.000 in 2020 ausgegangen ist. Um die Ausbildung dieser Resistenzen zu minimieren gilt es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Diese umfassen z. B. die zielgerichtete und sachgerechte Anwendung von Antibiotika, richtiger Umgang mit multiresistenten Erregern oder Minimierung des Eintrags von Antibiotika in die Umwelt. […]
Laufzeit
01.10.2020 – 30.09.2023
Förderkennzeichen
49 MF 200026
Gefördert vom
EuroNorm / BMWK (INNO-KOM)
Um die Klimaschutzziele des Bundes und der Länder zu erreichen, muss die Integration von Erneuerbaren Energieträgern im gesamten Energiesystem weiter forciert werden. Während in den letzten Jahren der Anteil Erneuerbarer Energien bei der Stromversorgung stets deutlich gesteigert werden konnte, besteht bei der regenerativen Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden noch Nachholbedarf, um die sächsischen
Klimaziele zu erreichen.
In Sachsen besteht aufgrund der historischen Prägung durch den Bergbau (elf große Bergbaureviere) ein einzigartiger Standortvorteil, der bei der Integration von regenerativen Energien eine große Rolle spielen kann. Zukünftig ist es für geeignete Gemeinden in Sachsen interessant, erneuerbare Energien durch die Nutzung des geothermischen Potentials von Grubenwässern bereitzustellen. Dies sind Wässer, die durch eine
Wasserhaltung im Altbergbau nach der Schließung von Bergwerken weiterhin abgepumpt werden müssen oder über Entwässerungsstollen abgeführt werden. Damit soll der Austritt und die Überflutung von ganzen Liegenschaften über Tage verhindert werden. Die Nachsorgemaßnahmen verursachen jährlich beträchtliche Kosten. Dabei können die durch die Flutung des Altbergbaus entstandenen unterirdischen Reservoirs als erneuerbare Energiequelle und Energiespeicher dienen. Grubenwassergeothermie kann somit als erneuerbare und lokale Energiequelle genutzt werden. Es stellt zudem aufgrund der ganzjährigen und witterungsunabhängigen Verfügbarkeit bei konstanten Wassertemperaturen eine grundlastfähige Energiequelle dar. Durch die Nutzung des Grubenwassers zur Gebäudekonditionierung kann aus der kostenintensiven Ewigkeitsaufgabe ein ökonomischer und ökologischer Synergieeffekt entstehen. […]
Laufzeit
22.07.2021 – 30.06.2023
Förderkennzeichen
100593187
Gefördert vom
Sächsische Aufbaubank /SMEKUL
Das Forschungsprojekt „Erstellung von Schulungsmaterial zum richtigen Heizen mit Holz“ hatte das Ziel, Schulungsmaterial zum richtigen Heizen mit Holz zu entwickeln. Hierbei wurden mit Hilfe von sechs Testpersonen Versuchs- und Schulungstage durchgeführt. Ein besonderer Fokus lag neben der theoretischen Vermittlung auf der praktischen Anwendung. Während der Prüfabbrände wurden Emissionen wie Staubmasse-, Partikelanzahl-, PAK-, CO-, NOX– und OGC-Konzentrationen über den kompletten Abbrand gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen flossen in die wissenschaftliche Bewertung des Projektes ein.
Laufzeit
01.11.2021 – 31.05.2023
Förderkennzeichen
372153 303 0
Gefördert vom
Umwelt Bundesamt
Ziel des Verbundvorhabens „LivingH2“ war die Demonstration einer Komplettlösung einer regenerativen H2-Stromversorgung in einer Reallaborumgebung unter Verwendung eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerks (H2-BZ-BHKW). Das Projektkonsortium bestand aus Industrie- und Forschungsinstituten in Deutschland und Frankreich.
Neben Koordination und Verbreitung der Ergebnisse gliederte sich das Projekt in folgende Aufgaben:
- Entwicklung optimierter Brennstoffzellen-MEA für den reinen H2-Betrieb
- Integration von MEAs in Stack- und Leistungsbewertung unter repräsentativen Bedingungen einschließlich der Auswirkungen der Odorierung
- Verbesserung und Entwicklung des BZ-KWK-Systems, einschließlich neuer Abgas- und Spitzenlastbrenner
- Installation und Demonstration eines kompletten Systems (erneuerbare H2-Erzeugung, H2-Verrohrung in einem Gebäude, Odorierung, H2-BHKW)
- Technoökonomische, ökologische und soziale Bewertung der Lösung
Laufzeit
01.10.2019 – 31.03.2023
Förderkennzeichen
03SF0587B
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung & Forschung
Projektträger Jülich
Unter den günstigen Rahmenbedingungen an der Wasserstoffeinspeiseanlage der Ontras GmbH in Prenzlau wurde eine mobile Pilotanlage in Containerbauweise zur individuellen Erzeugung von Erdgas/Wasserstoffgemischen mit bis zu 20 % Wasserstoffanteil errichtet. Untersucht wurden Membranen unterschiedlichster europäischer Hersteller, deren Membranmaterial, Größen und Geometrien variieren. Die Untersuchungen liefen unter Hochdruck bis zu 25 bar und den Membrangrößen angepassten Volumenströmen im Pilotmaßstab. Ziel der Abtrennung war die Unterschreitung des Wasserstoffgrenzwertes im Erdgas aus der DIN 51624 von 2 % im aufbereiteten Gasstrom mit geringen Methanverlusten. Interessierte Hersteller von Membranen für den angegebenen Trennzweck sind eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Laufzeit
02.03.2020 – 03.03.2023
Förderkennzeichen
G201920
Gefördert vom
ONTRAS Gastransport GmbH, GRTgaz S.A., Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH; Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Wesentliches Hauptziel der Studie war es, ein proaktives Planen und Errichten von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen zur Verhinderung bzw. Eingrenzung von (Groß-)Waldbränden in den sächsischen Wald- und Schutzgebieten anzuregen. In diesem Zusammenhang wurden die zukünftigen klimatischen Einflüsse szenarienbasiert antizipiert und mit weiteren Informationen im Kontext der Waldbrandrisiken angereichert. Die Auswertung der ermittelten waldflächenspezifischen Ergebnisse dienten als erste Indikation, in welchen Gebieten oder Gemeinden eine begründete Detailplanung erforderlich ist.
Laufzeit
19.07.2021 – 28.02.2023
Förderkennzeichen
100593013
Gefördert vom
Sächsische Aufbaubank /SMEKUL
Kerninhalte des DBI waren:
- Entwicklung eines bilanziellen Gastransportnetzmodells für Deutschland
- Untersuchung des Einflusses des Gastransportnetzes auf den innerdeutschen Energieaustausch bis 2045, insbesondere vor dem Hintergrund der Sektorenkopplung
- Entwicklung eines Modells zur regional hochaufgelösten Simulation von Ladeinfrastruktur
- Ableitung eines optimalen regionalen Mixes verschiedener Lade-Anwendungsfälle (z.B. Laden am Wohnort oder beim Arbeitgeber) bis 2045
- Regional hochaufgelöste Modellierung des Prozesswärmebedarfs der Industrie bis 2045
Laufzeit
01.09.2019 – 31.12.2022
Förderkennzeichen
03EI1001A; 03EI1001A-C
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft & Klimaschutz
Ziel des Forschungsprojektes war die Erörterung des Stands der Technik bei Direkttrocknungsanlagen. Aufgrund des Einsatzes von Direkttrocknungsanlagen in unterschiedlichen Branchen, wurde eine umfassende Übersicht erstellt. Diese sollte Aufschluss darüber geben, welchen Regelungen und Anforderungen die einzelnen Prozesse bzw. Anlagen unterliegen und wodurch diese Regelungen begründet sind.
Weiterhin wurde eine branchenspezifische Zusammenstellung von verwendeten Trocknungstechniken erstellt. Es wurden neben den Direkttrocknungsanlagen auch alternativ eingesetzte Indirekttrocknungstechniken beschrieben. Der Fokus der Untersuchungen lag dabei auf den Umweltauswirkungen der Trocknungsverfahren. Neben den Luftschadstoffen (Staub, NOx, SOx, Gesamtkohlenstoff, Formaldehyd, Ammoniak, …) wurde auch die Energieeffizienz betrachtet. In weiteren Arbeitspaketen wurde ermittelt, ob der Einsatz von direkten Trocknungsverfahren mit den entstehenden Emissionen durchgehend für alle betrachteten Trocknungsprozesse begründet ist. Abgrenzend dazu wurde untersucht, unter welchen Voraussetzungen welche Abgasreinigungsverfahren bei Direkttrocknern eingesetzt werden und ob somit vergleichbare Emissionswerte wie bei indirekten Trocknungsverfahren erreicht werden können. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wurden Optimierungspotentiale bei der Verwendung von Trocknungsverfahren aufgezeigt, um in zukünftigen Regelungssetzungsverfahren belastbare technische Anforderungen formulieren zu können.
Laufzeit
01.10.2019 – 31.12.2022
Förderkennzeichen
3719 53 302 3
Gefördert vom
Umweltbundesamt
In dem geplanten Vorhaben erfolgt die Teilnahme an der weltweit größten Messe der Glasbranche, der glasstec in Düsseldorf vom 20.-23.09.2022.
Dabei wurden das Unternehmen, die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, sowie die speziellen Produkte und Dienstleistungen nach langer Messepause wieder vorgestellt. Insbesondere die neue Generation optischer Sondensysteme für opto-akustische Untersuchungen konnten live präsentiert und bestaunt werden. Neben dieser innovativen Technologie wurden auch bereits etablierte Dienstleistungen des Consultings im Bereich Wärme- und energieintensiver Anlagen, gerade in der aktuellen Situation der Energieversorgung, angeboten.
Neben dem direkten und persönlichen Kontakt mit bestehenden und potenziellen Kunden diente die Messeteilnahme zusätzlich als Plattform der internationalen Vernetzung und des Austauschs bezüglich innovativer Technologien für eigene Produktentwicklungen.
Laufzeit
15.08.2019 – 22.11.2022
Förderkennzeichen
100386808
Gefördert vom
Sächsische Aufbaubank / SMWA
Kohlenmonoxid (CO) ist eine Grundchemikalie, die industriell breite Anwendung findet, aber überwiegend auf Basis fossiler Energieträger hergestellt wird. Im Rahmen des Vorhabens wird daher eine Möglichkeit erforscht und entwickelt, um CO direkt aus erneuerbarer elektrischer Energie und CO2 elektrokatalytisch herzustellen (power-2-X-Technologie). Diese ermöglicht insbesondere Anwendern, die bisher auf die Belieferung mit CO angewiesen sind, eine nachhaltige, kostengünstige Versorgung.
Laufzeit
01.01.2021 – 31.10.2022
Förderkennzeichen
100354357
Gefördert vom
Sächsische Aufbaubank
Das Ziel des europäischen Verbundprojektes „SuperP2G“ war die Senkung der Schwelle für die Validierung und Umsetzung von Power-to-Gas (P2G) für konkrete Need-Owner von „Smart Energy Systemen“, „Sektorkopplung“ sowie „Lokaler und regionaler Entwicklung“.
SuperP2G verband dazu führende P2G-Initiativen aus fünf europäischen Ländern, wodurch ein reger Wissensaustausch entstand. Jedes einzelne nationale Projekt konzentrierte sich auf andere Herausforderungen. Die beteiligten Forscher schlossen sich mit
lokalen Stakeholdern zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. SuperP2G konzentrierte sich auf die Zusammenführung und Weiterentwicklung bestehender Tools, einschließlich der Entwicklung zu Open Access. Ergänzend wurde eine Analyse der
bestehenden Regulierungen und Marktpotentiale, insbesondere durch das Einbeziehen von Stakeholdern aller beteiligten Nationen, durchgeführt.
Laufzeit
01.11.2019 – 31.10.2022
Förderkennzeichen
03EI4007A
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft & Klimaschutz
Zur Sicherung einer stabilen Gas-Versorgung der türkischen Wirtschaft ließ der türkische Gasversorger BOTAS in Zentralanatolien einen Untergrundgasspeicher (UGS) in einem Salzstock errichten. Der Salzstock befindet sich ca. 250 km südöstlich von Ankara, südlich des Salzsees „Tuz Gölü“. Im Endzustand des aktuellen Speicherprojektes besitzt der aus 12 Kavernen bestehende Speicher eine Kapazität von 1 Mrd. m³ Arbeitsgas.
Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (DBI GUT) bearbeitete als Joint Venture DBI TROYA, zusammen mit dem türkischen Ingenieurunternehmen Troya Dogalgaz Petrol Muhendislik San. ve Tic. Ltd. (TROYA), die Aufgaben des ingenieurtechnischen Bauherrnberaters (Owners Engineer). Das Aufgabenspektrum umfasste dabei das Consulting für das Engineering und die Errichtung der ober- und untertägigen Speicheranlagen (Bohrungen, Kavernen, Gas-Anlagen), der Gasanschlussleitung sowie der Solanlagen, inklusive einer 123 km langen Frischwasserzuleitung und einer ca. 50 km langen GFK-Soleabstoßleitung.
Laufzeit
2006 – 2021
Regenerativ erzeugter Wasserstoff ist ein Schlüsselenergieträger der Energiewende. Er kann als Energiespeichermedium zeitliche und räumliche Schwankungen ausgleichen, die bei der Energiebereitstellung und beim Energieverbrauch unvermeidbar sind. Damit Wasserstoff seine Stärke als kohlenstofffreier Energiespeicher („Power-to-Gas“) entfalten und zur Versorgungssicherheit beitragen kann, ist eine zuverlässige und sichere Versorgungsinfrastruktur nötig. Gemeinsam entwickeln daher die Verbundpartner DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS), REHAU AG + Co sowie die Fakultät Maschinenbau und Energietechnik der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig hierzu innovative Konzepte zur Anbindung von Verbrauchern (z.B. „H2-HOME“) am Standort Bitterfeld-Wolfen. Konkret wird ein Wasserstoffverteilnetz inkl. Hausanschlüsse mit einer bestehenden Wasserstoffpipeline verbunden. Hierbei werden Forschungsfragen zur Wasserstoffverteilung adressiert und die Versorgung von Wasserstoffverbrauchern (ebenfalls im HYPOS-Verbund) sichergestellt.
Laufzeit
01.11.2016 – 31.12.2021
Förderkennzeichen
03ZZ0708A
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines skalierbaren Co-Elektrolyse-basierten Verfahrenskonzepts zur Herstellung hochwertiger chemischer Produkte aus Wasser und CO2. Im Rahmen des Projekts soll dabei sowohl die Entwicklung als auch die Demonstration des Gesamtprozesses erfolgen. An einem Kalkwerk soll die vollständige Verfahrenskette ausgehend von der Entwicklung eines effizienten Verfahrens zur CO2-Abtrennung mittels keramischer Membranen aus dem industriellen Abgas über ein Hochtemperaturelektrolysemodul zur Synthesegasumsetzung bis hin zur Erprobung innovativer Ansätze für das Reaktordesign der Fischer-Tropsch-Synthese dargestellt werden.
Das DBI GUT ist verantwortlich für die Abtrennung des CO2 aus dem Abgas des Kalkwerkes. Die Abtrennung erfolgt mittels Membranen, wobei eine zweistufige Membrananlage vorgesehen ist. Auf diese Weise kann das CO2 in einer Reinheit ≥ 99 Vol.-% für den nachfolgenden PtX-Prozess bereitgestellt werden.
Partner: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Fraunhofer IKTS, Amtech, Bergmann Kalk
Laufzeit
01.12.2018 – 30.11.2021
Förderkennzeichen
03ZZ0741C
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Nach aktuellem Wissensstand bieten Salzkavernen hervorragende Voraussetzungen, um Grünen Wasserstoff aus stark fluktuierenden Prozessen wie Power-to-Gas langfristig zu speichern. Darauf aufbauend entwickelt das grundlagenorientierte Verbundprojekt H2-UGS eine standardisierte und übertragbare Methodologie zur zukünftigen Errichtung und Umrüstung von Salzkavernen für die Wasserstoffspeicherung. Diese Erkenntnisse fließen in einem wissenschaftlich fundierten Leitfaden zur standortunabhängigen Bewertung von Kavernen zusammen. Dabei werden Fragen der technischen Speicherintegrität und rechtlichen Genehmigung einbezogen.
Die offizielle Webseite des Projektes erreichen Sie unter:
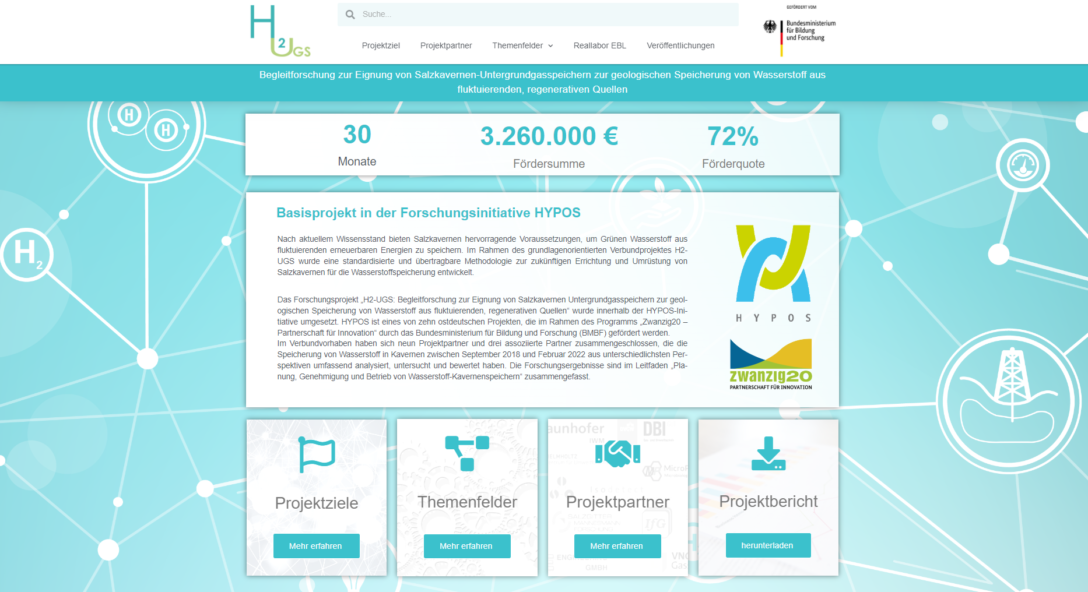
Laufzeit
01.09.2018 – 31.08.2021
Förderkennzeichen
03ZZ0721A
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Zielsetzung des Vorhabens war die Entwicklung eines Demonstrationsmusters zur Generierung von reinem Wasserstoff (H2) aus Erdgas für Industrie und Verkehr im Leistungsbereich von 100 m³(i.N.)/h.
Das System beinhaltet alle Module, welche für die vollständige Prozesskette der H2-Erzeugung notwendig sind: Gas- und Prozesswasseraufbereitung (Entschwefelung, Deionisierung), Gasumwandlung (Dampfreformierung, CO-Konvertierung) sowie die H2-Separation (Druckwechseladsorption). Um den Anforderungen in Bezug auf Mobilität und Flexibilität gerecht zu werden, wurde das System integrierbar für Standardcontainer ausgelegt.
Das entwickelte Verfahren zielte darauf ab, einer zahlenmäßig starken Gruppe von Nutzern den benötigten Wasserstoff vor Ort bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Transportwege und Verzögerungen wurden hierdurch vermieden, der Basis-Energieträger Erdgas wird optimal genutzt und Emissionen werden spürbar gemindert.
Laufzeit
01.12.2015 – 31.05.2021
Förderkennzeichen
01LY1410A
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Im Vorgängerprojekt H2-Index I wurde ein statisches Berechnungstool für die wirtschaftliche Bewertung von Innovationen entlang der Wertschöpfungsketten von Grünem Wasserstoff entwickelt. Das Tool diente in der ersten Phase der Beurteilung potenzieller HYPOS-Projekte. Im Folgeprojekt H2-Index II wird das Tool um folgende Bestandteile erweitert:
- Dynamische Betrachtung der Wertschöpfungsketten
- Basiswertschöpfungsketten, welche für das Ziel einer wirtschaftlichen Produktion von Grünem Wasserstoff besonders relevant sind
- Erweiterung der technologischen Komponenten Berücksichtigung sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen
- Einbindung regionalspezifischer Erzeugungs- und Abnehmerpotenziale
Mit Hilfe des H2-Index II wird eine ausführliche Systemanalyse der Wertschöpfungsketten durchgeführt, um potenzielle Geschäftsmodelle zu bewerten.
Laufzeit
01.06.2017 – 31.05.2021
Förderkennzeichen
03ZZ0733
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
In dem Verbundvorhaben haben sich die entscheidenden Akteure zusammengeschlossen, um den Ansatz einer Speicherforschungsplattform (SPF) für Grünen Wasserstoff umzusetzen und bis zu einem funktionierenden Geschäftsmodell weiterzuführen. Die SPF stellt ein Leuchtturmprojekt zur Entwicklung und Erprobung von Materialien und Technologien der großindustriellen H2-Speicherung aus erneuerbarem Strom dar. Auf diese Weise wird ein Reallabor geschaffen, in dem notwendige Erkenntnisse aus einem realitätsnahen Betrieb gewonnen werden können. Das Vorhaben wird in 3 Phasen bearbeitet.
Partner: DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, VNG Gasspeicher, Ontras, Fraunhofer IMWS, IfG
Laufzeit
01.05.2019 – 30.04.2021
Förderkennzeichen
01LY1410A
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ein gemeinsam geführtes Konsortium aus Avacon Netz GmbH und der Thüga AG möchte perspektivisch die betriebenen Gasverteilnetze für einen höheren Wasserstoffanteil ertüchtigen und daher feststellen, welche Maßnahmen für welche Komponenten erforderlich sind.
Zu diesem Zwecke wurde die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH im August 2018 beauftragt, ein Kompendium über den aktuellen Wissensstand zur Kompatibilität der betriebenen und nachgelagerten Assets sowie ausgewählter Systemaspekte zu erstellen. Hierbei wurden beliebige Erdgas-Wasserstoff-Gemische sowie reiner Wasserstoff betrachtet. Im Rahmen dessen wurde auch eine Herstellerumfrage durchgeführt und die Antworten in die Form von Produkt-Steckbriefen überführt.
Mit der Fertigstellung im Frühjahr 2019 ergaben sich weitere Handlungsbedarfe, die mit dem Beginn der „Folgeaktivität Produkt-SB“ im August desselben Jahres mündeten. Im Zuge dessen wurde das Konsortium für weitere Projektpartner geöffnet, so dass wir mittlerweile 28 Projektpartner aus drei Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) im „H2-Kompendium VNB“ begrüßen dürfen. Inhaltlich bedeutete die Folgeaktivität eine Aufbereitung und Weiterentwicklung der bestehenden Produkt-Steckbriefe. Weiterhin wurden in einer erneuten Umfrage die unbeantworteten Anfragen sowie neue Produkte, welche durch den erweiterten Projektkreis eingebracht wurden, erfasst. Übergeordnetes Ziel ist es, möglichst belastbare Aussagen durch die Hersteller (Konformitätsbewertungen) bezüglich der Wasserstoffeignung der jeweiligen Assets ausgestellt zu bekommen. Auf diesem Weg wurden mehrere Workshops veranstaltet, in denen die Hersteller und die Verteilnetzbetreiber aus dem Konsortium aktuelles Wissen sowie Erfahrungen austauschen und Handlungsbedarfe identifizieren konnten.
Laufzeit
01.08.2018 – 31.12.2020
Technologien wie Power to Gas nehmen eine Schlüsselrolle in zukünftigen Energiesystemen ein, denn sie ermöglichen erst die Integration erneuerbarer Energien in zukunftsweisende Versorgungssysteme. Ob Ausgleich fluktuierender Erzeugung- und Bedarfsverläufe, Entlastung und Stabilisierung des Stromnetzes durch netzdienlichen Anlagenbetrieb, Langzeit-Energiespeicherung, erneuerbarer Kraftstoff oder Umstieg auf grüne Prozesswärme: Schon jetzt zeigt Power to Gas seine Stärken allein in Deutschland bereits in über 30 Anlagen. Das für die Anlagenplanung erforderliche Genehmigungsverfahren ist jedoch für Planer, Generalunternehmer wie Behörden nach wie vor unübersichtliches Terrain und damit eine schwer kalkulierbare Kostenkomponente. Es fehlt an klaren Leitlinien und umfassendem Wissen zum aktuellen Stand der Technik und den anzuwendenden Regeln.
Im Projekt PORTAL GREEN wurde deshalb ein Leitfaden erstellt, der inhaltlich in zwei Teile gegliedert ist. Während der erste Teil sich mit genehmigungsrechtlichen Aspekten auseinander setzt, liegt der Schwerpunkt des zweiten Teils auf den Themen Planung, Bau und Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen. Das gesamte Kompendium wird nun in das DVGW-Regelwerk integriert. So wird sichergestellt, dass das erarbeitete Wissen zukünftig Bestandteil des täglichen Handwerkszeugs aller Prozessbeteiligten wird. Davon werden wichtige Impulse für die Projektierung weiterer PtG-Anlagen ausgehen und der Einsatz der Technologie im großtechnischen Maßstab kann weiter Fahrt aufnehmen.
Laufzeit
01.10.2017 – 31.12.2020
Förderkennzeichen
G 201735
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines innovativen Bewertungssystems (Pipeline Integrity Management System, PIMS) für die Betriebssicherheit von Leitungen zum Transport von wasserstoffreichen Gasen.
Folgende Teilziele wurden im Verlauf des Vorhabens erreicht:
- Entwicklung von Methoden zur Umnutzung bestehender Erdgasleitungen für den Transport von Wasserstoff und wasserstoffhaltigen Gasen.
- Anfertigung von Konzepten für die Instandhaltungsstrategie von Erdgastransportleitungen für Wasserstoff und wasserstoffhaltige Gase.
- Erstellung eines Sicherheitskonzepts für den Transport von Wasserstoff und wasserstoffhaltigen Gasen.
Laufzeit
01.07.2016 – 31.12.2019
Förderkennzeichen
03ZZ0707A
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Methanol ist ein wichtiger chemischer Grundstoff für die chemische Industrie und die Energiewirtschaft. Die Herstellung erfolgt bisher in großtechnischen Anlagen aus fossilen Rohstoffen. Bei hohen Temperaturen und Drücken entsteht aus den kohlenstoffhaltigen Ausgangsstoffen ein Synthesegas, das an einem Katalysator unter hohem Energieaufwand zu Methanol umgesetzt wird.
Das Konsortium unter Federführung der TU Bergakademie hat ein effizientes Verfahren entwickelt, das die CO2-Abtrennung aus Biogas oder Abgasen mit der Methanolsynthese kombiniert und milde Prozessbedingungen ermöglicht. Dabei kann das im Waschmittel gebundene CO2 direkt am Katalysator mit dem benötigten Wasserstoff zu Methanol reagieren, ohne vorher ausgetrieben zu werden. Durch diese innovative Maßnahme können die Prozessparameter deutlich gesenkt und eine hohe Energieeinsparung erzielt werden.
Partner: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, TU Bergakademie Freiberg, John Brown Voest, Amtech
Laufzeit
01.03.2017 – 29.02.2020
Förderkennzeichen
03ZZ0726B
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Im Projekt werden Kohlenstoffmembranen als Trenntechnologie für Wasserstoff-Erdgas-Gemische entwickelt und am Versuchsaufbau mit Realgasen getestet. Ziel ist mithilfe der Membranen den Wasserstoffgehalt in Gasgemischen situativ auf < 1 Vol.-% zu senken bzw. auf > 99 Vol.-% anzureichern. Die Membranen wären damit für den Einsatz an kritischen Erdgasnetzund Infrastrukturpunkten, wie CNGTankstellen, geeignet, welche unter derzeitigen Bedingungen lediglich Konzentrationen von < 2 Vol.-% erlauben.
Partner: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Fraunhofer IMWS
Laufzeit
01.12.2015 – 30.11.2018
Förderkennzeichen
03ZZ0706A
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ziel des Projektes ist die Evaluierung und Optimierung eines integrierten Systems zur hocheffizienten Nutzung von elektrischer Energie, Wärme- und Kälteenergie bereitgestellt auf Basis von 100% grünem Wasserstoff.
Dieses System ist charakterisiert durch:
- ein H2-BHKW auf Basis von Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen (NT-PEM-BZ),
- ein H2-basiertes Wärmeerzeugermodul inkl. Brennwertnutzung,
- eine leistungselektronische Verbundlösung zur parallelen Nutzung der elektrischen Energie auf AC und DC Level,
- eine auf die Anwendung abgestimmte innovative Speicherlösung für thermische und elektrische Energie,
- und ein abgestimmtes strahlungsbasiertes Klimatisierungssystem mit Wärmepumpe
Partner: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Fraunhofer IMWS, TU Bergakademie Freiberg, inhouse engineering GmbH, Enasys
Laufzeit
01.09.2016 – 31.08.2018
Förderkennzeichen
03ZZ0751B
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat den Förderantrag „Entwicklung innovativer, hocheffizienter Technologien zur Aufbereitung von Biogas/Biomethan über die komplette Wertschöpfungs- und Verwertungskette“ (inTeBi) bewilligt. Das Leittechnologie-Gesamtprojekt bestand aus insgesamt fünf Teilprojekten.
Einreichende Mitgliedsvereinigung des Leittechnologie-Gesamtprojekts ist die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Kooperierend traten die Forschungsvereinigungen DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. sowie der Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) auf.
Laufzeit
01.12.2013 – 31.12.2017
Förderkennzeichen
0325619D
Gefördert vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat den Förderantrag „Entwicklung innovativer, hocheffizienter Technologien zur Aufbereitung von Biogas/Biomethan über die komplette Wertschöpfungs- und Verwertungskette“ (inTeBi) bewilligt. Das Leittechnologie-Gesamtprojekt bestand aus insgesamt fünf Teilprojekten.
Einreichende Mitgliedsvereinigung des Leittechnologie-Gesamtprojekts ist die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Kooperierend traten die Forschungsvereinigungen DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. sowie der Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) auf.
Laufzeit
01.05.2015 – 31.10.2017
Förderkennzeichen
22LBG, 23LBG, 17963BG, 17965BG, 17985BG
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Die Speicherung von Erdgas erfolgt saisonübergreifend in Untergrundspeichern. Bei der Lagerung in unterirdischen Gasspeichern nimmt das Gas dabei sehr leicht Feuchtigkeit auf. Die Trocknung erfolgt in der Regel durch Triethylenglykol(TEG)-Absorptionstrocknungsanlagen. Die Regeneration des TEGs wird mittels Destillation bei 190°C bis 205 °C und einem Wassergehalt im TEG zwischen 2,0 – 0,5 Ma.-% durchgeführt. Durch die damit verbundene thermische Alterung des TEG, muss dieses regelmäßig ausgetauscht werden. Für Stillstandphasen während den Ausspeiseperioden muss das TEG in der Destillationskolonne auf einer konstant hohen Stand-by Temperatur (>> 100 °C) bereitgehalten werden und verursacht damit einen zusätzlichen hohen Energieverbrauch.
Als Alternative zur der konventionellen TEG-Aufbereitung wurde eine Pilotanlage zur TEG Trocknung mit anorganischen Membranen geplant und auf einem Erdgasspeicher errichtet. Vor der Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage wurden die keramischen Membranen unter realen, prozessnahen Bedingungen untersucht und stetig in ihren Trenneigenschaften weiterentwickelt.
Laufzeit
01.05.2014 – 30.04.2017
Förderkennzeichen
03ET1101B
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Die Projektziele waren die Darstellung der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit der dezentralen, diskontinuierlichen Erzeugung und Nutzung von Synthesegas aus regenerativ erzeugtem H2 und biogenem CO2, die Evaluierung der Verfügbarkeit von CO2 aus Klärgas und erforderlicher Aufbereitungsschritte sowie die
Bewertung der Hochtemperatur reversen Wassergas-Shiftreaktion (rWGS)
Partner: DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, atalysis, Miltitz Aromatics
Laufzeit
01.01.2016 – 31.12.2016
Förderkennzeichen
03ZZ0703B
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Damit das Stromnetz auch in Zukunft sicher und zuverlässig betrieben werden kann, müssen leistungsfähige, effiziente und kostengünstige Speichermöglichkeiten entwickelt werden. Die Kopplung von Strom- und Gasnetzen in ihrer Funktion als Energiespeicher könnte bisher noch nicht genutzte Potentiale bieten.
Die DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg übernimmt die Leitung des Projekt „KonStGas“, welches im Rahmen der „Förderinitiative Energiespeicher“ mit rund 3,1 Millionen Euro gefördert wird. In dieser ressortübergreifenden Initiative stellt das BMU gemeinsam mit dem BMWi und dem BMBF in einer ersten Phase bis 2014 rund 200 Millionen Euro für Forschungsvorhaben bereit. Ziel ist es, eine große Bandbreite von Speichertechnologien für Strom, Wärme und andere Energieträger weiter zu entwickeln.
Laufzeit
01.08.2013 – 30.09.2016
Förderkennzeichen
03255576A
Gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Am 01. September wurde die durch das BMBF geförderte Maßnahme „Eisenoxide als effiziente und kostengünstige Katalysatoren zur Aufbereitung und stofflichen Nutzung biogener Gase“ gestartet. Dieses Vorhaben gehört zum Programm „Unternehmen Region“ für die Neuen Bundesländer, womit das BMBF die Bildung regionaler Netzwerke unterstützen will, die für Ihre Region ein klar erkennbares, innovatives Profil entwickeln sollen. Inhaltlicher Schwerpunkt des gestarteten Vorhabens ist der Einsatz von eisenhaltigen Materialien in der Energiewirtschaft, zum Beispiel als Katalysatorsystem für chemische Synthesen oder Abgasreinigungsverfahren bzw. Adsorbentien für die Reinigung biogener Gase.
Im Mittelpunkt des Vorhabens steht ein zweitägiger Fachkongress, auf dem Leistungsträger aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zusammenfinden und Einsatz- sowie Entwicklungsmöglichkeiten von eisenhaltigen Materialien in der Energiewirtschaft diskutieren. Dieser Fachkongress fand am 23. und 24. Februar 2016 in Leipzig statt. Im Vorfeld werden Workshops anberaumt, in denen themenfeldbezogen die inhaltliche Ausrichtung des Fachkongresses, der Stand von Wissenschaft und Technik sowie Leitlinien für zukünftige Entwicklungen ausgearbeitet werden. Als Ergebnis des Innovationsforums soll ein starkes, regional orientiertes Netzwerk entstehen, das gezielt neue Märkte für eisenhaltige Materialien durch Etablierung von Wertschöpfungsketten und Initiierung marktorientierte Forschungsvorhaben erschließt.
Laufzeit
01.09.2015 – 28.02.2016
Förderkennzeichen
01HI15005
Gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Weitere Projekte der DBI-Gruppe finden Sie hier
Der DBI Newsletter.
Erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen vom DBI, ganz individuell auf Ihre persönlichen Interessen zugeschnitten.